This post was originally published on Good Impact
Tintenfische sind Meister im Täuschen. Einerseits besitzen sie in der Nähe des Anus Tintenbeutel voller Melanin, das sie bei Gefahr ausstoßen – um dank der Tintenwolke ungesehen zu verschwinden und ihre Fressfeinde zu irritieren. Andererseits können sie blitzschnell ihre Hautfarbe wechseln – zum Balzen, Tarnen oder Drohen. Den Farbwechsel steuern sie durch das Zusammenspiel dreier Hautschichten. Die unterste streut einfallendes Licht. So entsteht ein heller Grund, auf dem Farben besonders intensiv leuchten. In der Mitte brechen und verstärken winzige Kristalle das Licht und erzeugen so irisierende Farben. Oben schließlich Millionen winziger Pigmentzellen, umgeben von ringförmigen Muskeln. Spannen sich diese Muskeln an, breiten sich die Farbzellen auf der Haut aus. Entspannen sie sich, schrumpfen die Zellen – und die Farbe ist nicht mehr sichtbar. Das perfekte Zusammenspiel des Trios zaubert den Tintenfischen schillernde Muster auf die Haut.
Drei Schichten, die als Team Licht und Farbe steuern: Diese Idee möchte Benjamin Hatton, Professor für Materialwissenschaft an der Universität von Toronto, für Gebäude nutzbar machen – nicht um zu täuschen oder zu tarnen, sondern um Energie zu sparen. Denn: „Gebäude machen gut 40 Prozent des weltweiten Energieverbrauchs aus“, sagt Hatton. Besonders hoch ist der Verbrauch für Klimaanlagen in heißen Regionen – Tendenz steigend: „In Saudi-Arabien etwa gehen bis zu 70 Prozent des Stroms im Gebäudesektor für Klimatisierung drauf.“ Seit 2010 arbeitet er deshalb an einer der größten Energieschwachstellen von Gebäuden: ihren Fenstern. Die sollen Licht hereinlassen – aber bitte keine Hitze. Rollos helfen zwar gegen die Wärme, verdunkeln aber den Raum und machen künstliches Licht nötig. Was fehlt, ist eine Lösung, die Licht durch-, aber Hitze draußen lässt. Eine Art schlaue, kühlende Sonnenbrille für Gebäude.
Smarte Sonnenbrille
Inspiriert vom Tintenfischhaut-Trio hat Hatton eine solche Lösung entwickelt. Die Basis: drei transparente Kunststoffplatten, geschichtet wie ein Sandwich, jede durchzogen von haarfeinen Mikrokanälen, einem kaum sichtbaren Mini-Tunnelsystem. Winzige Pumpen, etwa im Fensterrahmen integriert, leiten verschiedene Flüssigkeiten in die Schichten, die dort baumartige Verästelungen bilden: Eine wasserbasierte Farblösung dimmt das Licht – so blendet es nicht. Eine andere mit Titandioxid-Partikeln streut es diffus – die Helligkeit verteilt sich gleichmäßig im Raum. Eine dritte Flüssigkeit enthält Eisenoxid, das die hitzeerzeugende Infrarotstrahlung absorbiert. So gelangt diese nicht in die Innenräume, sondern wird mit der Flüssigkeit abtransportiert. Drei Sensoren – für Temperatur, Licht und Flüssigkeiten-Durchfluss – messen laufend alle Parameter; gesteuert wird das Ganze digital. So entsteht ein autonomes, dynamisches Kühlsystem, das je nach Bedarf Licht und Wärme dosiert hereinlässt.
Besonders für Gebäude mit großer Glasfläche wäre das System geeignet, Bürotürme etwa oder Industriehallen. Man könnte es in neuen Fenstern verbauen oder als Folie auf bestehenden anbringen. Die Flüssigkeiten lassen sich austauschen, sind günstig und sicher. Titandioxid steht jedoch in der Kritik, umwelt- und gesundheitsschädlich zu sein – laut Hatton ließe es sich durch Kalk oder Silikat ersetzen. Noch steckt die Entwicklung in der Forschungsphase. Zwei Meter hohe Prototypen gibt es aber bereits.
Und der Energieverbrauch? Hattons Simulationen zeigen: Wenn Hitze, Licht und Blendung gezielt reguliert sind, lassen sich mit seinen Fenstern bis zu 43 Prozent Energie gegenüber industriegängigen Fensterlösungen einsparen. Der Verbrauch der winzigen Pumpen, die die Flüssigkeit etwa über ein Gebäudesystem steuern, ist mit 1 bis 5 Watt pro Quadratmeter drastisch kleiner als der von Klimaanlagen mit einer Kühlleistung von 60 bis 100 Watt pro Quadratmeter. Und ihr Betrieb wäre mit Solarkraft denkbar.
Ob sich das Fenster durchsetzt, ist ungewiss. „Die Baubranche ist konservativ“, sagt Hatton. Doch er sieht sie als Teil eines größeren Wandels: „Mich interessiert, wie technische und biologische Systeme zusammenwirken können.“ Begrünte Fassaden, reflektierende Wandfarben, adaptive Fenster: Gemeinsam könnten sie Gebäude schaffen, die sich intelligent an ihre Umgebung anpassen – wie Tintenfische.
The post Smarte Sonnenbrille à la Tintenfisch appeared first on Good Impact.

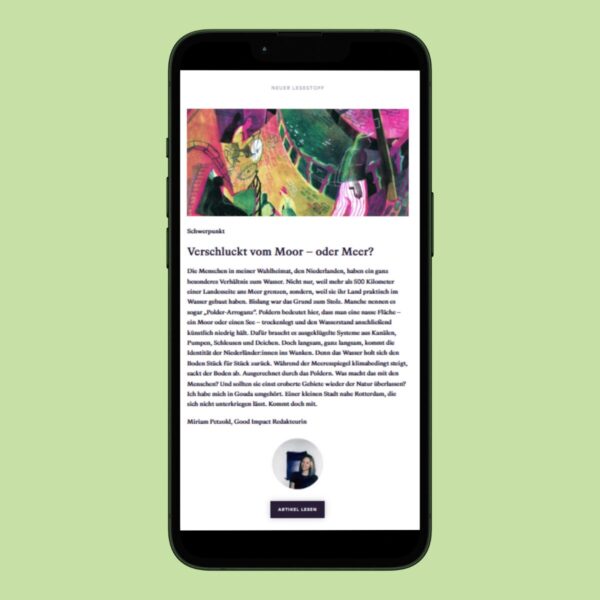
![Nachhaltiges Tagesgeld: Hier gibt es die besten Zinsen [August 2025]](https://komoneed.com/wp-content/uploads/2023/03/utopia-400x250.jpg)
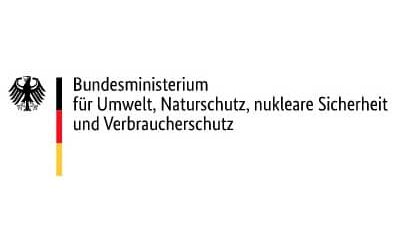

0 Kommentare