This post was originally published on Reset
Spätestens seit der Corona-Pandemie haben die meisten Menschen schon einmal von Halbleitern gehört. Da die Lieferketten damals zur Eindämmung der Pandemie angehalten wurden und die Nachfrage stark anstieg, mangelte es in Europa und den USA an Halbleitern und Computerchips. Diese wichtigen Komponenten, die in allen technischen Geräten stecken, werden von Unternehmen wie TSMC, Samsung und UMC produziert. Und die agieren fast vollständig in Südkorea und Taiwan.
Während Halbleiter und ihre Produktion in den letzten Jahren als geopolitisches Thema an Relevanz gewonnen hat, bleibt ein Aspekt dabei oft unerwähnt: Die Herstellung von Halbleitern ist extrem energieintensiv, benötigt Unmengen an Wasser und basiert auf hochreinen Materialien, deren Gewinnung ebenfalls aufwändig und vor allem umweltschädlich ist. So soll die Fertigung von Halbleitern im Jahr 2021 mit 175 Megatonnen an CO2-Äquivalenten die Menge der jährlichen Emissionen von rund 30 Millionen Menschen verursacht haben.
Ein Team aus Forschenden von der ehemals als Stiftung Neue Verantwortung bekannten Organisation Interface möchte für mehr Transparenz in den Umweltauswirkungen der Halbleiterindustrie sorgen. Julia Hess verriet uns im Interview, wie ihr „Semiconductor Emission Explorer“ funktioniert.
Tool soll unzureichende Datenlage ausgleichen
Entwickelt haben Julia und ihr Team den Emission Explorer, da sie bei ihrer Forschung zu den Umweltauswirkungen der Halbleiterproduktion auf ein Problem gestoßen sind: „Sehr viele sensible Daten und Geschäftsgeheimnisse werden nicht nach außen getragen. Die Informationen, mit denen wir arbeiten konnten, stammen eigentlich nur aus Jahresberichten und Social-Responsibility-Reports“, erzählte Julia uns im Gespräch via Videocall (und somit auch via Halbleiter!). „Alle anderen Informationen sind in teuren Datasets nur schwer zugänglich.“
Diesem Missstand ist das Team mit Pioniergeist entgegengetreten: „Wir wollten überlegen, was man aus den Daten machen kann, die wir haben und wollten dabei ursprünglich schauen, wie weit wir kommen.“ Mit dem „Semiconductor Emission Explorer“ ist daraus nun ein Tool entstanden, das Politiker:innen, Forschenden und Unternehmen mehr Entscheidungsmöglichkeiten gibt. Dazu sagt Julia:
„Über den Explorer kann man sich anschauen, wie hoch die Emissionen [… verschiedener Halbleiterhersteller …] sind und kann daraus politische Rahmenbedingungen schaffen. Darüber hinaus hilft es Unternehmen im asiatischen Raum einzuschätzen, wie es wäre, ihren Standort nach Europa oder in kühlere Länder zu verlegen.“ Das Tool sei zudem auch für Wissenschaftler:innen relevant, da es die Folgeprobleme der Produktion verschiedener Halbleiterarten in Bezug auf Energie- und Wasserverbrauch und deren Ressourcenintensität offenlegt.
KI-Prozessoren, Speicherchips und mehr – worum geht es hier überhaupt?
Um zu verstehen, warum ein zentraler Datensatz wichtig ist, müssen wir einmal auf die Halbleiterproduktion selbst eingehen. Aus technischer Sicht sind Halbleiter nach Stoffen benannt, deren Leitfähigkeit zwischen der eines Isolators und eines Leiters liegt. Durch eine komplizierte Verarbeitung von Materialien wie Silizium oder Germanium können diese so verändert werden, dass ihre Leitfähigkeit steuerbar wird, wenn ihre Temperatur oder elektrischen Felder verändert werden. Halbleiter haben daher eine wichtige Eigenschaft für Funktionsweise moderner Chipsätzen von Geräten wie Computern oder Smartphones.
Obwohl diese Darstellung stark vereinfacht ist, enthält sie für das Thema Nachhaltigkeit zwei wichtige Details: Einerseits benötigen wir Materialien wie Silizium und Germanium für deren Produktion. Andererseits müssen wir diese technisch kompliziert anpassen, um sie für moderne Chipsätze nutzbar zu machen.

Was ist eine Wafer-Scheibe?
Kurzer Exkurs für Nerds:
Um moderne Chipsätze in großen Stückzahlen zu produzieren, schneiden Halbleiterhersteller hochreine Siliziumbarren in dünne Scheiben und polieren sie anschließend.
Über Prozesse wie die Reinigung mit ultrareinem Wasser, die Dotierung, die Fotolithografie und Ätzungen lassen sich im Frontend auf diesen extrem glatten Oberflächen komplexe Strukturen und Schaltkreise erzeugen.
Die Waferscheiben werden dann zerschnitten und weitere Komponenten auf die Siliziumplatten aufgelötet – bis letztendlich ein fertiger Computerchip entsteht.
Bildquelle: Intel Corperation
Prozessoren, wie sie in jedem Smartphone, Notebook, in jedem modernen Auto und auch massenhaft in Rechenzentren arbeiten, beschreibt Julia Hess daher als sehr komplizierte Halbleiter. „Das Problem ist, dass man bei der Produktion einen sehr hohen Energieverbrauch hat. Die Produktion eines modernen Halbleiters kann bis zu drei Monate lang dauern und besteht aus Kühlprozessen und automatisierten Abläufen. Eine Wafer-Scheibe muss zudem wiederholt mit ultrareinem Wasser gereinigt werden, was auch zu einem erhöhten Wasserverbrauch führt.“
Wie können wir Halbleiter nachhaltiger herstellen?
Obwohl die Produktion von Halbleitern so kompliziert ist, steigt der Bedarf an Chipsätzen laut den Studienergebnissen von Julia und ihrem Team weiter an. „Das liegt einerseits am KI-Boom der letzten Jahre„, sagt die Forscherin. „Doch es gibt auch andere Einflussfaktoren. Autonome Waffensysteme benötigen leistungsstarke Prozessoren, genauso wie Drohnen, der Bereich der Robotik, aber auch allgemein die Rüstungsindustrie. Zwar brauchen sie nicht immer die modernsten Chips, aber die Nachfrage steigt. Auch Entwicklungen wie eine Elektrifizierung der Mobilität sind auf Halbleiter angewiesen.“
In ihrer Studie konnte das Forschungsteam aber auch erkennen: „69 Prozent des Energieverbrauchs sind auf fünf Unternehmen zurückzuführen, die Logik- und Speicherchips für KI und Unterhaltungselektronik fertigen“. Wir kommen also schwer drum herum, Computerchips nachhaltiger herzustellen.
Eine neue Wunderlösung durch Künstliche Intelligenz, wie sie einige Expert:innen prophezeien, hält Julia Hess für unwahrscheinlich. Wie in anderen Sektoren sind nachhaltige Praktiken in der Halbleiterproduktion aber längst bekannt:
„Wir brauchen besseres Recycling, eine funktionierende Kreislaufwirtschaft, die Nutzung erneuerbarer Energien, das Recycling von Wasser und eine konsequente Überlegung darüber, wie wir Abfälle aus der Produktion in anderen Industrien weiterverwenden können“. All das werde nicht mit der nötigen Ernsthaftigkeit betrieben – und aktuell hätten Unternehmen dafür auch zu wenig Anreize.
„Unternehmen, die in Asien agieren, bekommen kaum Druck. Dabei weiß die ganze Industrie Bescheid und trotzdem wird sich auf kurzfristige Lösungen und weniger auf langfristige Veränderungen konzentriert.“
Der „Semiconductor Emission Explorer“ ist genau hierfür also eine Orientierungshilfe. Mit transparenten Daten und einer besseren Vergleichbarkeit sollen Unternehmen und Politiker:innen nachhaltigere Entscheidungen treffen können. Dass das dringend nötig ist, zeigt laut Julia Hess ein aktuelles Beispiel.
AI Continent Plan unterstreicht Bedarf an zuverlässigen Daten
Mit ihrem „AI Continent Plan“ strebt die Europäische Kommission eine weltweite Führungsrolle im Bereich der künstlichen Intelligenz an. Die erst im April 2025 vorgestellte Strategie schafft dabei wirtschaftliche und technologische Rahmenbedingungen, um eine europäische KI zu entwickeln und langfristig anzuwenden.
Wie sieht eine grüne digitale Zukunft aus?
Elektroschrott, CO2-Emissionen durch KI, Wasserverbrauch von Rechenzentren – aktuell scheint die ungezügelte Digitalisierung nicht mit einem gesunden Planeten vereinbar. Doch es gibt viele Lösungen für eine ökologische und faire Digitalisierung – wir haben sie recherchiert:
Teil dieses Plans ist die Errichtung von fünf AI-Gigafactories, die Entwickler:innen die technische Grundlage für die Entwicklung einer europäischen KI beziehungsweise eines europäischen LLMs stellen sollen. Jedes dieser Rechenzentren soll dabei rund 100.000 KI-Chips enthalten. Julia Hess nennt diesen Plan als Beispiel dafür, dass in der Technologiepolitik eine langfristige Strategie mit Augenmaß fehlt:
„Es fehlt an vielen Stellen eine Koordinierung von Strategien im Halbleiter- und KI-Bereich, die Ziele aneinander anzupassen und Synergien zu schaffen. Vielleicht sollten wir erst einmal überlegen: Wofür brauchen wir Gigafactories?“ Deren Errichtung würde einerseits viel Geld verschlingen, das dann wiederum für Nachhaltigkeitsprojekte fehlt. Andererseits benötigen wir dafür wiederum Halbleiter, die aktuell nicht nachhaltig und lokal produziert werden – und die womöglich nach wenigen Jahren bereits wieder veraltet sind.

Dieser Artikel ist Teil des Dossiers „Digital und grün – Lösungen für eine nachhaltige Digitalisierung“, in dessen Rahmen wir Lösungen für eine ökologische und faire Digitalisierung vorstellen. Wir danken der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU) für die Projektförderung!
Du willst keinen Artikel zum Thema verpassen? Dann abonniere unseren Newsletter oder RSS-Feed und folge uns auf Mastodon, Bluesky oder LinkedIn!
The post Moleküle der digitalen Welt: Wie die Halbleiter-Industrie nachhaltiger werden kann appeared first on Digital for Good | RESET.ORG.



![Nachhaltiges Tagesgeld: Hier gibt es die besten Zinsen [August 2025]](https://komoneed.com/wp-content/uploads/2023/03/utopia-400x250.jpg)
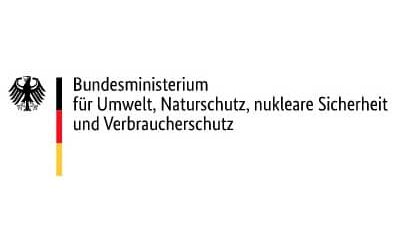

0 Kommentare