This post was originally published on Good Impact
Die reichsten zehn Prozent der Haushalte besitzen in Deutschland zusammen etwa 60 Prozent des Gesamtvermögens, die Zahl der Millionär:innen steigt ebenso wie Einkommensungleichheit und Armut. Nun will die Bundesregierung das Bürgergeld durch eine Art abgespeckte Grundsicherung ersetzen. Frau Spannagel, ist unser Sozialstaat noch gerecht?
Dorothee Spannagel: Gerechtigkeit hat viele Dimensionen. Welche Kriterien legt man an? Wer mehr leistet, soll mehr haben? Wer mehr braucht, soll mehr bekommen? Unser Sozialstaat ist im Grundgesetz verankert, berücksichtigt Aspekte von Bedarfsgerechtigkeit – wer braucht was – ebenso wie Aspekte von Leistungsgerechtigkeit – wer verdient wie viel? Wer mehr in das Rentensystem eingezahlt hat, erhält auch mehr. Aber in den letzten Jahrzehnten wurde der Sozialstaat erheblich zurückgebaut, zumindest in Teilen. Das ist ein internationaler Trend, auch in Frankreich oder UK etwa. Gerecht ist vieles keineswegs.
Zum Beispiel?
Spannagel: 563 Euro im Monat gibt es für die erste erwachsene Person in einem Haushalt (plus Geld für Wohnen und Heizen). Das ist viel zu wenig, um davon zumindest grob am allgemeinen Wohlstand wie Mobilität, Kultur, Sozialleben teilhaben zu können. Eine systematische Fehlsteuerung. Auch jenseits der Grundsicherung sehe ich Schieflagen: So werden Frauen immer noch benachteiligt, Care-Arbeit wird wenig honoriert, die Folge ist oft Altersarmut. Bei Vermögen und Einkommen geht es eher um steuerpolitische Gerechtigkeit …
… Sozialstaat im engen Sinne meint, dass der Staat sich um soziale Gerechtigkeit und Sicherheit bemüht, indem er soziale Leistungen und Schutz vor Risiken wie Krankheit, Alter, Arbeitslosigkeit, Pflege sicherstellt …
Spannagel: … der Ansatz basiert auf dem Prinzip der Solidarität, alle Bürger:innen zahlen Beiträge, um die Leistungen für diejenigen zu finanzieren, die sie brauchen. In der internationalen Forschung umfasst Wohlfahrtsstaat auch Bildung, aber hierzulande zählt sie nicht im engen Sinn zum Sozialstaat. Ich habe nie verstanden, warum. Bildungserfolg hängt in Deutschland extrem von sozialer Herkunft ab. Laut Bildungsbericht 2024 erwerben Kinder aus Akademiker:innenfamilien dreimal so häufig einen Hochschulabschluss wie Kinder aus Nicht-Akademiker:innenfamilien. Das hat viele Gründe, aber einer ist die strukturelle Benachteiligung.
Dirk Assmann: Ja, es ist wichtig, dass der Sozialstaat für faire Startchancen sorgt. Grundsätzlich ist für mich die Frage: Was verstehen wir unter einem gerechten Sozialstaat? Ich verstehe darunter nicht, dass möglichst viele möglichst viel bekommen und Ungleichheiten dadurch so weit wie möglich ausgeschlossen werden. Gemessen an der Sozialleistungsquote – dem Verhältnis von Sozialleistungen zu Bruttoinlandsprodukt – haben wir im Vergleich zu den 2010er-Jahren durchaus eine Ausweitung des Sozialstaats. Für mich zählen drei Punkte: Chancengerechtigkeit; Unterstützung für jene, die sie wirklich brauchen; Leistungsgerechtigkeit, Leistung muss sich lohnen, wer arbeitet, sollte auch mehr haben.
Spannagel: Aber unsere Gesellschaft hat ein sehr verkürztes Bild von Leistungsträger:innen. Es sind eben nicht vor allem die top Führungskräfte und Unternehmer:innen, die Arbeitsplätze schaffen und so viel zur Gesellschaft beitragen. Genauso wichtig sind die Altenpfleger:innen, Menschen, die auf dem Bau arbeiten, Mütter und Väter, die Care-Arbeit machen. Leistung muss sich wieder lohnen? Das kann man auch andersrum drehen. Warum setzen wir nicht den Mindestlohn höher, damit auch Altenpfleger:innen profitieren? Die Einführung des Mindestlohns war ein wichtiger Schritt. Der Lohnabstand zwischen Grundsicherung und Erwerbsarbeit ist doch nicht nur dadurch erreichbar, dass wir den Sicherungsempfänger:innen weniger geben. Sondern auch dadurch, dass man die Löhne erhöht.
Assmann: Ich halte den Mindestlohn für das völlig falsche Prinzip. Wir brauchen Steuererleichterungen und weniger Sozialabgaben, um den Abstand zwischen Lohn und Grundsicherung herzustellen. Mindestlohn zerstört Arbeitsplätze, er belastet Unternehmen zu sehr.
Spannagel: Herr Assmann, wir haben jetzt seit zehn Jahren den Mindestlohn. Von Anfang an wurde gewarnt: Wenn wir den einführen, geht die Wirtschaft vollends den Bach runter. Aber das ist nicht passiert.
Assmann: Die Gewerkschaften wollen den Mindestlohn von 12,82 Euro auf 15 Euro erhöhen. Das ist definitiv zu viel. Die unabhängige Mindestlohnkommission, die regelmäßig über die Höhe entscheidet, verlangt, dass die wirtschaftlichen Gegebenheiten berücksichtigt werden …
Spannagel: … aber dazu gehört auch die Inflation, derzeit 2,2 Prozent, insofern sind 15 Euro Mindestlohn absolut angemessen. Außerdem finden viele Grundsicherungsempfänger:innen über den Mindestlohnsektor auf den Arbeitsmarkt zurück. Die Bezahlung muss stimmen, sonst sind sie als Aufstocker:innen wieder auf Zuschüsse vom Staat angewiesen, weil es anders nicht zum Leben reicht. Dann haben wir arbeitende Arme.
Dennoch erhöht die neue Bundesregierung den Druck: In der Reform des Bürgergeldes soll wohl der „Vermittlungsvorrang “ gelten: Hauptsache irgendeine Arbeit antreten.
Spannagel: Ich halte das für sehr bedenklich. Arbeit um jeden Preis bringt es nicht. Dann gibt es sogenannte Drehtüreffekte, raus aus der Grundsicherung, wieder rein, weil man einen schlecht qualifizierten Job schneller verliert. Wenn wir die Leute dauerhaft in Arbeit bringen wollen, müssen wir sie ordentlich qualifizieren.
Assmann: Sicher ist das gut. Es gibt aber auch den gegenteiligen Effekt zur Drehtür, den Aufstieg in Arbeit. Nur wer arbeitet, hat die Chance aufzusteigen. Und vergessen wir nicht: Die Wirtschaft braucht alle Arbeitskräfte, die sie bekommen kann, nicht nur Fachkräfte. Denken Sie an die Gastronomie, da müssen viele Betriebe die Öffnungszeiten zurückfahren, weil das Personal fehlt.

Etwa 5,5 Millionen Menschen bekommen Bürgergeld, 1,8 Millionen davon sind Minderjährige, mehr als 2 Millionen können aus anderen Gründen nicht arbeiten. Nur 1,7 Millionen stehen dem Arbeitsmarkt zur Verfügung.
Assmann: Das ist immer noch eine große Gruppe. Unsere Studie „Wachstumsbooster Arbeitsmarkt“ hat 2024 gezeigt: Wenn wir allein die 1,7 Millionen Bürgergeldempfänger:innen auf den Arbeitsmarkt bringen würden, könnte unsere Wirtschaftsleistung um 11 Prozent ansteigen. Gelänge es zudem, Teilzeitkräfte und Rentner:innen zu aktivieren, wären wir sogar bei 15 Prozent.
Die neue Bundesregierung plant bereits mehr Sanktionen, mehr Kontrollen, mehr Auflagen für Empfänger:innen.
Spannagel: Mir sind keine Studien bekannt, die belegen, dass härtere Sanktionen mehr Menschen in Arbeit bringen. Die Streichung der Leistungen – wenn man etwa Beratungstermine nicht wahrnimmt – ist nach einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts ohnehin nicht mit dem Grundgesetz vereinbar.
Assmann: Aber die Gesellschaft braucht das Zeichen, dass der Staat genau kontrolliert, ob Menschen das System ausnutzen. Im April 2025 hat eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey gezeigt: 70 Prozent lehnen das Bürgergeld ab, vor allem weil die Sanktionen zurückgefahren wurden. Dabei bin ich ganz sicher: Die meisten Menschen wollen arbeiten gehen. Aber es gibt eine Grauzone, wo man schon sagen kann, das ist sehr an der Grenze. Das stört das Gerechtigkeitsempfinden der Bevölkerung ganz massiv.
Spannagel: Kennen Sie noch Florida-Rolf? Anfang der 00er-Jahre soll er von Hartz IV in Florida Urlaub gemacht haben. Solche anekdotischen Fälle wurden medial unfassbar aufgeblasen. Das Thema der sozialen Hängematte ist alt, aber ich denke schon, dass die Akzeptanz des Sozialstaats derzeit zurückgeht. Mit dem Bürgergeld wurde massiv Wahlkampf gemacht – und mit dem Narrativ der Bürgergeldempfänger:innen, die lieber die Beine hochlegen, als sich um einen Termin beim Jobcenter zu bemühen. Zunehmend werden Gruppen gegeneinander ausgespielt: Wenn wir das Bürgergeld nicht absenken, ist nicht mehr genug für alle da …
… dabei fließen weniger als sieben Prozent des Bundeshalts in das Bürgergeld, zwei Drittel des Sozialbudgets werden in Renten und Gesundheit investiert …
Spannagel: … und doch heißt es: Wenn wir die Grundsicherung stärken, reicht es nicht mehr für Rente, Gesundheit und Pflege, und dann nehmen uns die Migrant:innen noch viel weg. Botschaft: Wir können entweder die Mitte absichern oder die unten, beides schaffen wir nicht. So werden in der Mittelschicht gefährliche Verunsicherungen geschürt: Wenn ich arbeitslos werde, falle ich in ein löchriges soziales Netz mit unzureichenden Leistungen. Man akzeptiert den solidarischen Sozialstaat ja nur, wenn man weiß, im Bedarfsfall greift er auch für mich – und zwar ausreichend.
Assmann: Deshalb brauchen wir eine starke Wirtschaft, damit der Kuchen, den es zu verteilen gilt, groß genug bleibt. Die Kritik am Sozialstaat gab es schon immer, ich sehe auch keine Auflösung des Solidariätsgefühls. Nur bei Missbrauch. Daher ist das Gerechtigkeitsgefühl so wichtig. Es kann nicht sein, dass der Staat, wie zurzeit, Bürgergeldempfänger:innen noch ein Jahr lang eine teure Wohnung zahlt. Wie wollen Sie das begründen?
Spannagel: Wer Grundsicherung in Anspruch nehmen muss, soll doch bitte die Zeit haben, sich um einen Job zu bemühen, statt sich auf einem überteuerten Markt um eine günstige Wohnung kümmern zu müssen und aus dem sozialen Umfeld rausgerissen zu werden. Zumal nur ein Drittel das Bürgergeld länger als vier Jahre bezieht. Auch wird oft übersehen: Immer weniger Menschen nehmen Sozialleistungen in Anspruch. Es hat ein schlechtes Image. Und gerade wer erwerbstätig ist, weiß oft gar nicht, dass es Anspruch auf Zuschüsse gibt. Manche trauen sich nicht zur Behörde. Das spricht nicht für eine hohe Akzeptanz des Systems. Wir müssen gut verständlich und leicht zugänglich erklären, was jedem zusteht. Das ist eine Bringschuld des Sozialstaats.
Assmann: Absolut, der Sozialstaat ist viel zu bürokratisch. Insbesondere Estland macht vor, wie ein einfacher, unbürokratischer und digitaler Sozialstaat aussehen kann.
Spannagel: Auch werden wir uns Gedanken über eine faire Finanzierung des Sozialstaats machen müssen – und Menschen mit hohem Einkommen viel mehr zur Kasse bitten. Warum schaffen wir nicht die Beitragsbemessungsgrenzen für Sozialabgaben ab, erhöhen den Spitzensteuersatz und führen die Vermögenssteuer wieder ein? Vom Sozialstaat haben schließlich alle etwas, auch die sehr Wohlhabenden. Er liefert Bildung, medizinische Versorgung und natürlich sozialen Frieden.
Assmann: Leistungsträger mehr zu besteuern, halte ich ebenso für falsch wie höhere Sozialabgaben für Unternehmen. Die sind schon am Limit und tragen meiner Meinung nach genug bei. In einem stimme ich Ihnen zu: Wir sollten uns stärker bewusst machen, wie wichtig ein funktionierender Sozialstaat für unsere Gesellschaft ist.
The post Ist unser Sozialstaat noch gerecht? appeared first on Good Impact.

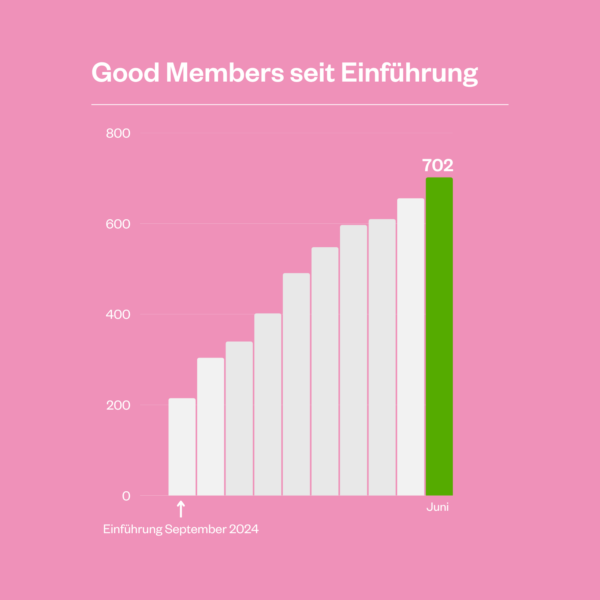
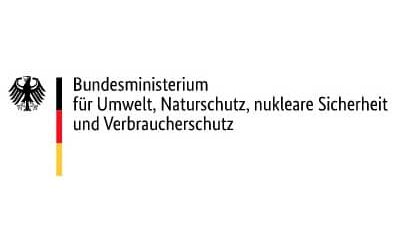
![Nachhaltiges Tagesgeld: Hier gibt es die besten Zinsen [August 2025]](https://komoneed.com/wp-content/uploads/2023/03/utopia-400x250.jpg)

0 Kommentare