This post was originally published on Reset
Stellen wir uns eine mittelgroße Stadt vor – nennen wir sie „Fairfields“. Fairfields hat seit langem mit Verkehrsstaus zu kämpfen, die nach Ansicht der Einwohner:innen zu einer starken Luftverschmutzung führen. Zudem hat das Fairfields Hospital mit einem überlasteten Gesundheitssystem zu kämpfen.
Jede Behörde in Fairfields verfügt über eine eigene digitale Infrastruktur: Das Verkehrsamt nutzt Verkehrssensoren, die Umweltbehörde überwacht die Luftqualität und das öffentliche Krankenhaus sammelt Gesundheitsdaten. Diese Daten werden jedoch nicht geteilt; jede Behörde hat nur Zugriff auf ihre eigenen Datensätze.
Stell dir nun vor, Fairfields führt eine gemeinsame Datenplattform ein – einen sicheren, transparenten Raum, in dem anonymisierte Daten aus den Bereichen Verkehr, Umwelt und Gesundheit zusammengeführt und im Kontext analysiert werden können.
Dank der Verkehrsdaten stellt der Stadtrat von Fairfields fest, dass bestimmte Kreuzungen während der Schulzeiten ständig verstopft sind. Die Luftverschmutzung steigt in diesen Zonen stark an, messen die Luftqualitätssensoren. Und die Gesundheitsakten des Krankenhauses zeigen ein Muster von Asthma-bedingten Krankenhausaufenthalten aus den umliegenden Stadtvierteln.
Fairfields wird aktiv. Es führt eine Mitfahrinitiative ein, baut Radwege aus und installiert intelligente Ampelsysteme, um Staus zu reduzieren und den Schwerverkehr von den Schulen wegzuleiten.
Et voilà – die Straßen sind freier, die Umweltverschmutzung ist geringer und die Belastung der Lungenabteilung des Fairfields Hospital sinkt deutlich. Sowohl die Gesundheitsversorgung als auch die Gesundheit der lokalen Bevölkerung verbessern sich, was im besten Fall zu einer glücklicheren und sichereren Bevölkerung führt. Weiter so, Fairfields!
Städte, wie wir sie kennen, sind nicht nachhaltig
Von verstopften Straßen bis hin zu explodierenden Emissionen – die Städte von heute stehen vor beispiellosen Herausforderungen. Mit der wachsenden Stadtbevölkerung verschärft sich auch die Klimakrise und die traditionelle Infrastruktur bricht unter der Verkehrslast zusammen. Um diese Herausforderungen zu bewältigen, kann es helfen, wenn Städte smarter werden.
Laut einem aktuellen Bericht des Bundesministeriums für Wohnungsbau, Stadtentwicklung und Bauwesen (BMWSB) hat COVID-19 Städte auf der ganzen Welt dazu motiviert, „auf Daten, technologische Instrumente und datenbasierte Maßnahmen zurückzugreifen“. Seoul beispielsweise nutzte seine Dateninfrastruktur zur Kontaktverfolgung, während „Melbourne sein Fußgängerdrucksystem einsetzte, um die Aktivitäten in der Stadt zu überwachen und Maßnahmen zur Erholung zu informieren“.
Auftritt: Die intelligente Stadt oder „Smart City“
Die sogenannte Smart City oder intelligente Stadt ist keine neue Idee. Das Konzept ist eine Vision für das Leben in Städten, die auf dem Einsatz von Technologie zur Schaffung nachhaltigerer, effizienterer und reaktionsfähigerer Umgebungen basiert und seit den 1990er Jahren kursiert. Doch seit die rasante Urbanisierung auf eine zunehmende Geschwindigkeit der Digitalisierung trifft ist klar, dass die Smart City nicht mehr nur eine futuristische Vision ist. Vielmehr scheint sie eine notwendige Antwort auf einige der drängendsten Herausforderungen unserer Zeit.
Durch die Integration digitaler Lösungen in Energiesysteme oder den öffentlichen Nahverkehr positionieren sich intelligente Städte an vorderster Front im Kampf gegen den Klimawandel und für die Energiewende.
Herausforderungen bestehen jedoch weiter – und neue kommen hinzu.

Was ist eine „Smart City“?
Laut der Europäischen Kommission „ist eine Smart City ein Ort, an dem traditionelle Netzwerke und Dienste durch den Einsatz digitaler Lösungen zum Nutzen der Einwohner und Unternehmen effizienter gestaltet werden“. Dazu gehört der Einsatz von Technologien zur Verbesserung des Ressourcenverbrauchs, zur Senkung der Emissionen, zur Gewährleistung sauberer Wasserversorgung, zur Verdichtung der städtischen Verkehrsnetze und zur Bewältigung aller anderen Aufgaben, von denen eine Stadt profitieren kann.
Laut dem IMD Smart City Index führen Zürich, Oslo und Genf die Liste der intelligentesten Städte der Welt im Jahr 2025 an.
Foto von Henrique Ferreira auf Unsplash.
Intelligente Städte brauchen mehr als nur Technologie: Sie brauchen Vertrauen
Obwohl Smart-City-Technologien weit verbreitet sind, haben viele Städte Schwierigkeiten, sie in die Praxis umzusetzen. Ein Beispiel dafür ist das Quayside-Projekt in Toronto. Unter der Leitung von Sidewalk Labs (einer Tochtergesellschaft von Alphabet, der Muttergesellschaft von Google) sollte eine datenoptimierte Smart Neighborhood entstehen, um alles von Verkehr bis Energieverbrauch zu verbessern. Der Entwurf von 2017 sah „Regenmäntel“ vor – ausfahrbare Überdachungen, die sich je nach Wetterlage ein- und ausfahren lassen, modulare Holzpflastersteine, autonome Fahrzeuge und bezahlbarer Wohnraum.
Für Alphabet war der Zugang zu modernster Technologie natürlich kein Problem. Unklare Datenverwaltung, mangelnde Transparenz und Misstrauen zwischen öffentlichen und privaten Akteuren führten jedoch dazu, dass Quayside 2020 schließlich eingestellt wurde.
Ein Großteil der Kritik richtete sich gegen die Geldgeber des Projekts. Big Tech steht hinter vielen Smart-City-Initiativen. Das lässt Bedenken hinsichtlich Gewinnmotiven und der Kommerzialisierung der Daten der Bürger:innen aufkommen. Sidewalk Labs warb zwar mit der Idee einer öffentlichen „Datentreuhand“, um die Privatsphäre zu schützen, doch die Kritiker:innen waren nicht überzeugt. Jim Balsillie, Mitbegründer des BlackBerry-Herstellers Research in Motion, bezeichnete Quayside als „kolonialistisches Experiment des Überwachungskapitalismus“.
Diese Formulierung ist sehr drastisch, verdeutlicht aber die Hauptsorge der Öffentlichkeit. Viele befürchten, dass kommerzielle Smart-City-Technologien in erster Linie den Interessen von Unternehmen dienen und erst in zweiter Linie denen der Gemeinden. Und das nicht ohne Grund. Tech-Giganten sind schließlich Unternehmen und keine öffentlichen Dienstleister. Daten, insbesondere Nutzerdaten, sind für ihr Geschäftsmodell von grundlegender Bedeutung. Sie sind der Treibstoff für ihre Dienste, prägen ihre Strategien und steigern ihre Gewinne. Das muss zwar nicht automatisch bedeuten, dass sie nicht an der Gestaltung der Städte der Zukunft mitwirken dürfen. Aber es bedeutet auf jeden Fall, dass ihre Projekte in unseren Städten und Wohnungen immer einer genauen Prüfung bedürfen.
Zusätzlich sollten solide und inklusive Vereinbarungen zum Datenaustausch und vor allem eine Aufklärung und Zustimmung der Öffentlichkeit bestehen. Schließlich basieren Städte auf Menschen und Gemeinschaften, nicht auf Sensoren, Servern oder Umsätzen, sondern sind „soziotechnische Systeme von Systemen“, ein lebender Organismus, der gedeiht, wenn technische und soziale Systeme zusammenwirken.
Smart Cities sind soziale Systeme
Ein kürzlich veröffentlichter Leitfaden des VTT Technical Research Centre of Finland schlägt vor, dass der Erfolg von intelligenten Städten vor allem durch Datenaustausch gefördert werden kann. Der Bericht argumentiert, dass die Entwicklung von Smart Cities verschiedene Fähigkeiten, Investitionen und Technologien erfordert und dass nur ein kooperativer Ansatz sinnvoll ist. Erinnerst du dich noch an Fairfields? Warum sollte jede Abteilung oder jedes Unternehmen ein eigenes System isoliert aufbauen, wenn eine gemeinsame Infrastruktur und offene Standards die Effizienz insgesamt verbessern könnten?
Die Autor:innen des Leitfadens, Pasi Pussanen, Jutta Suksi und Maija Federley, erklärten gegenüber RESET, dass Transparenz entscheidend ist, um die Akzeptanz in der Bevölkerung sicherzustellen. „Der Schlüssel zur Förderung einer aktiven Bürgerbeteiligung an Initiativen zum Datenaustausch liegt darin, Transparenz in der Entwicklungsphase datenbasierter Dienste und eine einfache Nutzung dieser Dienste zu gewährleisten“. Dies könne alles umfassen, „von der Sensibilisierung bis hin zur aktiven Beteiligung am Datenaustausch und der Datennutzung“.
Geteilte Daten stellen den Menschen in den Mittelpunkt
Ein Beispiel für eine erfolgreiche Umsetzung in der Praxis ist Hamburg. Die Stadt ist seit Jahren Vorreiter in Umfragen zum Thema Smart City. Die digitale Strategie für das gesamte Stadtgebiet konzentriert sich auf die Verbesserung der Lebensqualität der Einwohner:innen und gleichzeitig auf die Ökologisierung und wirtschaftliche Attraktivität der Stadt. Eine ziemlich große Aufgabe. Aber es scheint zu funktionieren.
Seit 2018 liegen die Schwerpunkte des Transformationsprozesses in Hamburg auf nachhaltiger und effizienter Technologie, einer städtischen Datenplattform und einem standardisierten und dezentralisierten Ökosystem für den Datenaustausch. Die Urban Data Platform beispielsweise ist eine robuste, dezentralisierte Datenaustauschplattform, die standardisierte APIs nutzt, um städtische Systeme und Datenbanken miteinander zu verbinden. Sie liefert offene Daten in Echtzeit, um die Entscheidungsfindung zu verbessern und einen Mehrwert in den Bereichen Mobilität, Stadtplanung, öffentliche Dienstleistungen und anderen wichtigen Bereichen zu schaffen. Hamburg belegte mit 86,2 von 100 möglichen Punkten den zweiten Platz im Smart City Ranking 2024.
Entscheidend ist jedoch, dass Transparenz im Mittelpunkt dieser digitalen Strategie steht. Die vom Senat 2020 verabschiedete Digitale Strategie für Hamburg betont die Stärkung der proaktiven Bürgerbeteiligung. Der Aktionsplan 2022 der Stadt wurde in Zusammenarbeit mit zivilgesellschaftlichen Organisationen, Bürger:innen und Verwaltungsmitarbeiter:innen entwickelt. Transparenz und Sicherheit stehen dabei im Mittelpunkt der Datenverwaltung. Der Ansatz „Teilen, nutzen, schützen“ der Stadt Hamburg gewährleistet den Zugang zu Daten, während strenge Datenschutz- und Sicherheitsmaßnahmen die Informationen der Bürger:innen schützen.
Die Strategie ist also menschenzentriert und zielt darauf ab, die Lebensqualität durch nachhaltige und inklusive digitale Lösungen auf der Grundlage eines gemeinsamen Datenökosystems und der Beteiligung aller zu verbessern. Dabei werden jedoch weder die Privatsphäre geopfert noch Big Tech einbezogen.
Wie sieht eine grüne digitale Zukunft aus?
Elektroschrott, CO2-Emissionen durch KI, Wasserverbrauch von Rechenzentren – aktuell scheint die ungezügelte Digitalisierung nicht mit einem gesunden Planeten vereinbar. Doch es gibt viele Lösungen für eine ökologische und faire Digitalisierung – wir haben sie recherchiert:
Neue Vorschriften könnten Städten helfen, ein Gleichgewicht zu finden
Zumindest in der EU mindern Vorschriften zum Datenaustausch und zum Datenschutz einige der Risiken, denen angehende intelligente Städte gegenüberstehen. Der Data Governance Act zielt einerseits darauf ab, das Vertrauen in den freiwilligen Datenaustausch zu stärken. Der Data Act hingegen soll Innovationen fördern, indem Hindernisse für den Datenzugang beseitigt werden. Letzteres hilft auch bei der Beantwortung einer weiteren häufig gestellten Frage: Wem gehören die Daten innerhalb eines Smart-City-Ökosystems? Laut den Autor:innen des Leitfadens „Data Ecosystems for Smart Sustainable Cities“ sollte „jeder Dateninhaber innerhalb eines Smart-City-Ökosystems die Kontrolle über den Zugang zu und die Nutzung seiner Daten haben“, wodurch er zum Souverän seiner Daten wird. Der Datenaustausch sollte gefördert werden und wird beispielsweise durch den Common European Data Spaces Act gefördert.
Diejenigen, die den Empfehlungen folgen, werden besser gerüstet sein, um Daten als Instrument zur Verbesserung des städtischen Lebens, zur Reduzierung von Emissionen und zur Steigerung der allgemeinen Lebensqualität ihrer Einwohner zu nutzen. Letztendlich hängt die Zukunft smarter Städte von ihrem Engagement für das Gemeinwohl ab – wo Technologie und menschenzentrierte Werte Hand in Hand gehen.

Dieser Artikel ist Teil des Dossiers „Digital und grün – Lösungen für eine nachhaltige Digitalisierung“, in dessen Rahmen wir Lösungen für eine ökologische und faire Digitalisierung vorstellen. Wir danken der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU) für die Projektförderung!
Du willst keinen Artikel zum Thema verpassen? Dann abonniere unseren Newsletter oder RSS-Feed und folge uns auf Mastodon, Bluesky oder LinkedIn!
The post Intelligentere Städte durch gemeinsame Datennutzung: Warum Technologie allein Städte nicht nachhaltiger macht appeared first on Digital for Good | RESET.ORG.






![Nachhaltiges Tagesgeld: Hier gibt es die besten Zinsen [August 2025]](https://komoneed.com/wp-content/uploads/2023/03/utopia-400x250.jpg)
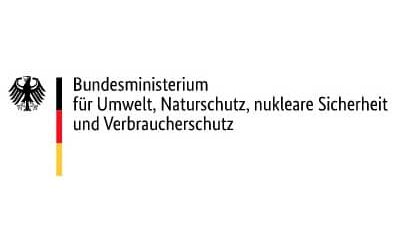

0 Kommentare