This post was originally published on Reset
Dass Streaming umweltschädlich ist, hat als Thema vor einigen Jahren größere Wellen geschlagen. Dann kam der Hype um KI und im speziellen Generative AI und die neue, energie- und wasserintensive Technologie hat Streaming als den großen Klimasünder abgelöst. Doch auch wenn es um die Umweltauswirkungen der Übertragung von Bewegtbild und Musik stiller geworden ist, hat sich an der ökologischen Brisanz des Themas nichts geändert. Im Gegenteil sogar, denn es wird immer mehr gestreamt. Schon heute hat Video-Streaming mit geschätzten 60 bis 70 Prozent den größten Anteil am globalen Internetdatenverkehr. Zeit also, mit dem wachsenden CO2-Fußabdruck der Digitalisierung das Thema „nachhaltiges Streaming“ wieder auf die Agenda zu setzen.
Tatsächlich hat sich in den letzten Jahren in diesem Bereich einiges getan. Zwar verstehen wir noch immer nicht ganz genau, wie hoch die CO2-Emissionen des Streamings im Detail sind. Aber wir wissen genug, um an den wesentlichen Stellschrauben zu deren Reduktion drehen zu können.
Wir sind mitten in einem stetig anschwellenden Datenstrom
Videoplattformen wie Youtube und Co. und Social-Media-Kanäle fluten uns jeden Tag mit Millionen Videos. Die Mediatheken der öffentlich-rechtlichen Rundfunksender liefern uns ein permanent verfügbares Unterhaltungsangebot auf den heimischen Bildschirm. Stundenlanges Binge-Watching über Streaming-Plattformen ist für viele mittlerweile Alltag. Spotify und andere Musikstreaming-Plattformen spielen die Musik zu allem, was wir tun. Und sollten sich das Metaverse und Videostreaming-Brillen wirklich irgendwann durchsetzen, dann streamen wir praktisch mit jedem Atemzug.
Wenn wir online auf „Play“ klicken, geht es natürlich nicht nur im reine Unterhaltung. Wir nehmen online an Weiterbildungen teil, lernen mit Video-Tutorials und unsere Meetings finden in Videokonferenzen statt. Das Streamen von Bildern und Tönen durchdringt alle Lebensbereiche.
Die Datenübertragung kennt dabei kaum Limits. Datensparsamkeit war bis vor wenigen Jahren noch wichtig, damit die Inhalte problemlos über unsere Bildschirme flirten. Doch mit immer leistungsfähigeren Geräten, fast unbegrenzten Telefon- und Internetflatrates und Abos bei Streaming-Diensten spielt es weder für uns noch für die Anbieter eine Rolle, wie viele Video-Inhalte wir jeden Monat abspielen.
Das alles addiert sich zu einem großen Datenstrom, der beständig weiter wächst.
Gesamtemissionen durch Streaming: Aus vielen Rinnsalen wird ein reißender Fluss
Die weltweit größte On-Demand-Streaming-Plattform Netflix meldete Ende 2024 weltweit 301,63 Millionen Mitgliedschaften mit teilweise mehreren Zuschauer:innen. Nach Angaben des Unternehmens haben diese Nutzer:innen im Laufe des Jahres unglaubliche 94 Milliarden Stunden an Inhalten gestreamt. In der Rangliste der größten Plattformen folgen darauf Amazon Prime mit schätzungsweise 200 Millionen zahlenden Kernabonnent:innen und Disney+ mit 122,7 Millionen. Gleichzeitig legen auch neue Plattformen an Popularität zu. Indiens größte Streaming-Plattform JioHotstar kam 2025 durch die Übertragung der Cricket-Liga nach eigenen Angaben auf rund 280 Millionen Abonnent:innen.
Damit ist klar, dass wir es mit einem massiven Datenvolumen zu tun haben, dass von Servern auf unsere Bildschirme geschickt wird. Wie hoch aber sind die CO2-Emissionen des Streamings? Eine Vielzahl von Forschungsprojekten und Studien hat sich bereits mit dieser Frage beschäftigt. „Die Studien zeigen jedoch einen großen Spread, von 36 bis 440 Gramm CO2-Äquivalenten pro Stunde“, sagt Maria Zeitz, die das vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) geförderte Projekt „Green Streaming“ bei KlimAktiv leitet, im Interview mit RESET. 100 bis 175 Gramm CO2 pro Stunde Streaming schätzte 2020 zum Beispiel eine Studie des Hamburger Borderstep Instituts. Das entspricht ungefähr den Emissionen eines Kleinwagens bei einem Kilometer Autofahrt. Eine Untersuchung der englischen Organisation Carbon Trust kam 2021 zu einem weniger alarmierenden Ergebnis. Danach verursacht eine Stunde Streaming in Europa nur ungefähr 55 Gramm CO2.
Dieser Wert erscheint erstmal gering. Doch aufgrund des enormen weltweiten Streaming-Konsums ist der CO2-Fußabdruck auch damit erheblich. Auf Grundlage der 55 Gramm CO2 pro Stunde schätzt ein neuerer Artikel die Streaming-Emissionen von Netflix, Amazon Prime Video und Disney+ auf rund 11 Millionen Tonnen.
Doch die drei der beliebtesten On-Demand-Plattformen machen mit 36,3 Prozent nur einen Teil der weltweiten Streaming-Aktivitäten aus. Nimmt man alle geschätzten 1,8 Milliarden Streaming-Abonnements zusammen, könnten die Gesamtemissionen aller Streaming-Dienste rund 30 Millionen Tonnen CO2 im Jahr betragen. Das entspricht 13,7 Prozent der jährlichen Emissionen Spaniens im Jahr 2022 oder 48,1 Millionen Einfachflügen von Paris nach New York.
Wie sieht es mit dem Streaming-Volumen von YouTube und Pornhub aus?
Es gibt eine Videostreaming-Plattform, die alle On-Demand-Plattformen übertrifft: YouTube. Mit täglich über einer Milliarde Stunden an gestreamten Inhalten ist sie die weltweit meistgenutzte Plattform.
Da ein Großteil der YouTube-Nutzung auf kleineren Geräten wie Smartphones und Laptops mit einer niedrigeren Auflösung stattfindet, sollten auch die CO2-Emissionen pro Stunde Streaming niedriger sein. Dennoch summiert sich das allein durch die pure Anzahl an Nutzer:innen zu einer beträchtlichen Gesamtbilanz. Multipliziert man den Schätzwert von 55 Gramm CO2 pro Stunde mit dem weltweiten Streaming-Volumen von YouTube, ergibt sich ein jährlicher Streaming-Ausstoß der Plattform von etwa 20,08 Millionen Tonnen CO2.
Während YouTube die weltweit meistgenutzte Videostreaming-Plattform ist, ist Pornhub die zweitgrößte Streaming-Website nach Traffic. Pornhub verzeichnet schätzungsweise 66 Milliarden Besuche pro Jahr. Bei einer durchschnittlichen Sitzungsdauer von 9 Minuten und 40 Sekunden entspricht dies etwa 10,63 Milliarden Stunden an gestreamten Videos jährlich. Mit dem Schätzwert von 55 Gramm CO2 pro Stunde betragen die jährlichen Streaming-Emissionen der Plattform etwa 585.000 Tonnen CO2.
Mit den zugrundliegenden 55 Gramm an CO2-Äquivalenten pro Stunde Videostreaming kommen also alle großen Plattformen zusammen auf schätzungsweise rund 50 Millionen Tonnen CO2 im Jahr. Die Streaming-Angebote der Fernsehsender sind hier übrigens nicht eingerechnet. Legt man andere Zahlen zugrunde, könnten die Emissionen auch wesentlich höher sein, wovon viele andere Studien ausgehen.
Die sehr unterschiedlichen Ergebnisse in den verschiedenen Studien kommen dadurch zustande, dass ihnen verschiedenen Methoden, Annahmen und Datensätze zugrunde liegen. Ein Vergleich ist daher nur schwer möglich. Die Studie von Carbon Trust, die unter anderem von Netflix finanziert wurde, gilt mittlerweile als eine Art Standard. Sie bezieht den Stromverbrauch der Endgeräte mit ein, nicht aber deren Produktion und den Filmdreh.
Warum Musik-Streaming einen geringeren CO2-Fußabdruck hat als Video-Streaming
Musik-Streaming ist aus mehreren Gründen weniger CO2-intensiv als Video-Streaming:
Geringerer Datenverkehr pro Stunde: Musikdateien benötigen deutlich weniger Bandbreite als hochauflösende Videos.
Effizientere Wiedergabegeräte: Musik wird häufig auf Smartphones und Laptops gestreamt, die weniger Energie verbrauchen als Fernseher.
Keine Videoverarbeitung: Streaming-Plattformen wie Netflix benötigen zusätzliche Rechenleistung für die Videokodierung und -wiedergabe, was den Energiebedarf erhöht.
Trotz dieser Vorteile hat auch Musik-Streaming erhebliche Umweltkosten. Allein auf Spotify haben 640 Millionen Nutzer:innen 2024 geschätzte 176,55 Millionen Kilo CO2-Äquivalent verursacht. Kostenpflichtiges Musikstreaming macht aber nur 23 Prozent des gesamten Musikstreamings aus. Das bedeutet, dass kostenlose Angebote und andere Hörmethoden die Gesamt-Emissionen weiter erhöhen – zusammen mit neuen Trends. Spotify spielt zu vielen Songs mittlerweile Videos ab und das schwedische Unternehmen hat angedeutet, sich künftig noch stärker in Richtung YouTube entwickeln zu wollen.
Damit ist klar, dass Streaming einen hohen Preis für Umwelt und Klima hat. Und dass sich Streaming auf ein sparsameres Modell zubewegen muss, sollen die globalen Durchschnittstemperaturen nicht noch weiter in die Höhe klettern. Besonders herausfordernd dabei ist, dass der Trend aktuell eher in Richtung höhere CO2-Emissionen geht, da durch den weltweit zunehmenden Video-on-Demand-Konsum, Autoplay-Funktionen, Live-Streaming und hochauflösende Inhalte (4K, 8K) der Energieverbrauch steigt.
Aber es gibt Stellschrauben, den ökologischen Fußabdruck zumindest zu begrenzen. Um zu verstehen, wo diese sind, sollten wir uns erst einmal anschauen, wo eigentlich die Emissionen beim Streaming entstehen.
Wann entstehen beim Streaming CO2-Emissionen?
Vermutlich machen sich die wenigsten Nutzer:innen Gedanken darüber, wieviel CO2 in die Atmosphäre gepustet wird, während die aktuelle Lieblingsserie oder ein Film über den Bildschirm flimmert. Für die meisten von uns ist dieser Vorgang genauso immateriell wie magisch. Hinter jedem Video steckt jedoch eine sehr physische Infrastruktur. Rechenzentren speichern die Inhalte, Content Delivery Networks (CDNs) übertragen sie rund um den Globus und Endgeräte empfangen und geben sie wieder. Jeder dieser Schritte verbraucht Energie, die zu den globalen CO2-Emissionen beiträgt.
Der Leitfaden des Projekts „Green Streaming“, den Fraunhofer FOKUS zusammen mit Autor:innen von LOGIC, der deutschen Telekom und KlimAktiv erstellt hat, nennt die Übertragung von Videoinhalten von der Quelle bis zu den Endverbraucher:innen ein „komplexes digitales und physikalisches System mit zahlreichen Abhängigkeiten und einer Vielzahl von Marktteilnehmern.“ Und genau das ist auch der Knackpunkt, warum es so schwer ist, die genauen CO2-Emissionen von Streaming zu ermitteln. Denn deren Höhe variiert je nach Gerät, Netzwerk und Rechenzentrum. Und viele der Marktteilnehmenden teilen ihre Zahlen nicht.
Im Projekt „Green Streaming“ will man daher die Schätzungen, die in vielen Studien in die Bewertung von Streaming einfließen, durch gemessene Werte ergänzen. „Erst dann, wenn wir genau wissen, wie viel Energie eine Stunde Streaming verbraucht und wie viele Treibhausgasemissionen dabei erzeugt werden, lassen sich Maßnahmen für klimaschonenderes Streaming ableiten“, sagt Maria Zeitz, die das Projekt leitet.
Doch so ganz am Anfang stehen wir hier zum Glück nicht mehr. Auch wenn die Höhe der Emissionen je nach Berechnungsmethode variiert, so sind viele Zusammenhänge mittlerweile erwiesen. Der Leitfaden nennt als wesentliche Erkenntnisse:
- Der Hauptteil der Energie in der Streaming-Wirkkette von ca. 70 bis 80 Prozent wird von den Endgeräten der Nutzenden verbraucht. Dabei variiert der Energieverbrauch von verschiedenen Gerätetypen. So verbraucht ein Smart-TV während der Wiedergabe in der Regel mehr Energie als ein Smartphone.
- Distributionsnetze weisen auch dann einen hohen Energiebedarf auf, wenn keine Daten übertragen werden. Man spricht hier von der sogenannten „Idle Load“. Diese liegt nach Schätzungen bei 50 bis 70 Prozent des Gesamtenergiebedarfs der Netze.
- Glasfaser ist hinsichtlich des Stromverbrauchs die effizienteste Technologie zur Verteilung von Streaming-Inhalten.
Aus diesen Erkenntnissen lassen sich konkrete Empfehlungen für Nutzende ableiten.
Wie geht Green Streaming?
- Am Anfang der Einsparungen stehen Endgeräte
· Kleinstmöglichstes und energieeffizientestes Gerät nutzen: Laut der Studie Green Streaming hat ein Smart-TV mit HDR einen 20-Mal größeren Energiebedarf als das Smartphone. Daher gilt die Empfehlung, auf dem kleinstmöglichen und energieeffizientesten Gerät zu streamen.
· Viele Geräte haben außerdem einen Energiesparmodus, den es sich zu nutzen lohnt.
· Lange nutzen, reparieren, gebraucht kaufen: Damit zusammen hängt auch, die Geräte möglichst lange zu nutzen, da dadurch weniger hergestellt werden müssen.
- Auflösung: Small is beautiful
Die Auflösung des Videos hat einen Einfluss auf den Energiebedarf und den CO2-Fußabdruck. Laut einer Studie der Bitkom benötigt das Streaming mit SD-Auflösung auf einem Smartphone, Tablet oder Notebook beispielsweise deutlich weniger Energie als das klassische Fernsehen oder das Abspielen einer DVD auf einem größeren Flachbildfernseher.
Generell gilt daher: Je geringer die Auflösung des Videos ist, desto weniger Energie muss beim Streamen aufgebracht werden. Gerade beim Smartphone oder bei einem Laptop mit kleinem Bildschirm macht eine niedrige Auflösungen keinen erkennbaren Unterschied.
Zusätzlich kann auch die Helligkeit reduziert werden.
- WLAN vor mobilen Daten
Eine Untersuchung im Auftrag des Umweltbundesamts hat ergeben, dass je nach Übertragungstechnik unterschiedlich viel Treibhausgasemissionen verursacht werden. Die geringste CO2-Belastung entsteht, wenn das Video über einen Glasfaser-Anschluss gestreamt wird. Auch eine Übertragung über ein Kupferkabel ist sparsamer als über Mobilfunk.
In Mobilfunknetzen gibt es ebenso große Unterschiede. So wird bei einer Datenübertragung mit der 5G-Technik deutlich weniger verbraucht als mit UMTS (3G).
- Autoplay deaktivieren
Webseiten wie Instagram oder YouTube, aber auch viele Mediatheken spielen Clips und Videos oft automatisch ab, um uns am Bildschirm zu halten. Auch dieses „unabsichtliche“ Streamen treibt den Datenverkehr in die Höhe. Daher: Wenn möglich Autoplay ausschalten.
- Werbeblocker nutzen
Werbeeinspielungen in Form von kurzen Videos haben einen nicht unerheblichen Anteil am Streaming-Angebot. Damit könnte das Online-Marketing noch mehr ins Gewicht fallen als das Streaming-Verhalten von Einzelpersonen. Wirkungsvolle Apps wie zum Beispiel der kostenlose Open-Source-Werbeblocker uBlocks Origin verhindern Werbeinspielungen.
- Weniger Binge, mehr Wertschätzung
Beim nachhaltigen Streamen geht es auch darum, unsere Beziehung zu digitalen Inhalten zu verändern. Statt in den Bilderrausch abzutauchen, können wir den eigenen Medienkonsum verlangsamen und die Nutzung zeitlich und räumlich begrenzen. Weniger Binge, mehr Wertschätzung eben!
Richtig Musik hören
Auch wenn Musikstreaming einen niedrigeren Energiebedarf hat, lässt sich mit wenig Aufwand an einigen Schrauben drehen.
· Songs herunterladen: Lade die Songs und Alben, die du oft hörst, in deine Bibliothek. Das ist sparsamer, als sie jedes Mal neu zu streamen.
· Keine YouTube-Musik: Wenn die über den Streaming-Dienst Musik hörst, wird meistens auch ein Video abgespielt. Das treibt den Datentransfer unnötig in die Höhe. Das Geiche gilt übrigens auch für Spotify: Auch hier solltest du die Video-Funktion deaktivieren.
· Plugins nutzen: Sollte es einen Song oder einen Vortrag nur auf YouTube oder einer anderen Video-Plattform geben, dann kannst du Plugins wie zum Beispiel YouTube Audio nutzen. Damit wird nur der Ton des Videos gestreamt.
Darüber hinaus könne jeder noch „das Übliche“ tun, wie Maria Zeitz es nennt. „Durch den Bezug von echtem Grünstrom die Energiewende vorantreiben und für eine sinnvolle Klimapolitik stimmen.“
Aber auch seitens der Unternehmen gibt es wesentliche Stellschrauben, um die CO2-Emissionen bei der Übertragung von Ton und Bild zu reduzieren.
Welchen Einfluss haben Streaming-Anbieter auf die CO2-Emissionen?
Um zu verstehen, an welchen Stellen Unternehmen ansetzen können, werfen wir einen etwas detaillierteren Blick darauf, was auf Anbieterseite passiert.
Damit Videos auf unseren Bildschirmen abgespielt werden können, müssen sie zuerst auf den Servern der Streaming-Dienste bereitgestellt werden. Bei diesem sogenannten Ingest- und Encoding-Prozess werden die Inhalte in verschiedenen Formaten und Auflösungen für die jeweiligen Endgeräte und Bandbreiten verfügbar gemacht.
An die Endnutzer:innen verteilt werden die Inhalte über spezialisierte Netzwerke, die Content Delivery Networks (CDNs). Sie verringern die Latenz und verbessern die Ladegeschwindigkeit. Zudem können sie den Datenverkehr reduzieren, indem sie Inhalte auf Servern ablegen, die geografisch näher bei den Nutzer:innen liegen.
Verarbeitet und gespeichert werden die Inhalte auf Servern in Rechenzentren. Die CO2-Emissionen variieren hier je nach Art des Stroms, mit dem das Rechenzentrum betrieben wird. Je grüner der Strom, desto niedriger die CO2-Emissionen.
Um bei der Bereitstellung der Video-Inhalte Energie zu sparen, können die Datenmengen mithilfe von Kompressionsverfahren, auch Video-Codecs genannt, reduziert werden. „Die richtige Wahl der zum Einsatz kommenden Encodier-Verfahren kann einen relevanten Beitrag zur Energieeinsparung leisten“, stellen die Autor:innen der Studie Green Streaming fest. Allerdings gibt es keine „one fits all“-Lösung. Die optimale Lösung ist abhängig vom Streaming-Workflow, dem zu adressierenden Endgerät und Nutzungsszenario, also ob es sich um ein Live-Event, ein On-Demand- Video oder Social-Media handelt.
Das Problem im CDN-Netzwerk ist, dass die Server einen hohen Grundstromverbrauch haben. Sie werden 24/7 betrieben, unabhängig davon, wie viele Daten tatsächlich transportiert werden. Laut dem Netzwerkausrüster Nokia benötigen die Netze ungefähr 70 Prozent des Energiebedarfs im Leerlauf und in Zeiten geringer Auslastung. Eine dynamischere Gestaltung der Verteilnetze könnte somit Energie einsparen.
Das Gleiche gilt auch für das restliche „Internet“ bzw. das Kernnetzwerk, – also die Infrastruktur aus Rechenzentren, Switches und Antennen für das mobile Netz. „Insbesondere im mobilen Netz haben die Antennen einen hohen Anteil am gesamten Stromverbrauch der Infrastruktur“, berichtet Maria Zeitz. „Die Telekommunikationsanbieter planen in Zukunft, Teile der Antennenarrays in einzelnen Mobilfunkzellen abzuschalten, solange kein Bedarf besteht. Diese dynamische Gestaltung könnte ersten Schätzungen zufolge 15 bis 20 Prozent des Energiebedarfs im mobilen Netz einsparen.“
Die Rechenzentren dagegen, die den größten Energiebedarf im Festnetz haben, können derzeit noch nicht dynamisch abgeschaltet werden. Dennoch reduzieren sich die CO2-Emissionen deutlich, wenn Unternehmen auf grüne Rechenzentren setzen.
Die Emissionen des Streamings zu senken liegt also nicht nur in den Händen der Nutzer:innen, sondern auch bei Netz- und Rechenzentrenbetreibern, Telekommunikationsanbietern als auch Streaming-Diensten. Aber was passiert in diesem Bereich wirklich?
Was tun Unternehmen und die öffentlich-rechtlichen Sender?
Die Big Player im On-Demand-Streaming haben in den letzten Jahren mehr oder weniger ambitionierte Nachhaltigkeitsstrategien vorgelegt. Netflix zum Beispiel hat sich zum Ziel gesetzt, seine Emissionen bis 2030 um 50 Prozent gegenüber dem Niveau von 2019 zu senken. Außerdem deckt das Unternehmen nach eigenen Angaben seit 2022 seinen weltweiten Stromverbrauch zu 100 Prozent mit Zertifikaten für erneuerbare Energien. Amazon Prime hat sich dagegen vorgenommen, bis 2040 klimaneutral zu werden und Disney+ strebt an, seine direkten Emissionen bis 2030 um 46,2 Prozent gegenüber 2019 zu reduzieren. Das klingt erstmal vielversprechend. Doch die Vorhaben sind mit Vorsicht zu genießen, solange diese freiwillig sind. Außerdem sind die Geschäftsmodelle der Plattformen umso erfolgreicher, je mehr wir streamen.

Wie Netflix die Filmindustrie verändert
Worum es in diesem Artikel nicht geht ist die „Netflixisierung“ der Filmindustrie und Gesellschaft. Wer mehr darüber erfahren möchte, wie das On-Demand-Streaming-Unternehmen Filme aus den Kinos geholt und zu einem schnell konsumierbaren Produkt im immer-gleichen Look gemacht hat, dem empfehlen wir diesen Podcast von Paris Marx im Gespräch mit dem New Yorker Journalisten Will Tavlin.
Sehr interessant ist dagegen, was im öffentlich-rechtlichen Rundfunk in puncto Nachhaltigkeit passiert. Denn einerseits kommt den Sendern aufgrund der Beitragsfinanzierung eine besondere gesellschaftliche Verantwortung zu. Andererseits hat das Streaming einen großen Anteil an den CO2-Emissionen der Sender. Dies hat uns auch Birgit Gabriel, Nachhaltigskeitsbeauftragte bei ARTE, bestätigt: „Im Bereich der Distribution des ARTE-Angebots entfallen 97 Prozent der CO2-Emissionen auf die nichtlineare Verbreitung, also das Streaming. Lediglich drei Prozent entfallen auf die ‚klassische‘ lineare Verbreitung unserer Signale via Satellit und Kabel.“ Ähnlich dürfte es auch bei anderen Fernsehsendern aussehen.
Maria Zeitz berichtet, dass der RBB im „Green Streaming“-Projekt mitwirkt und die Methoden für ein grüneres Streaming mitentwickelt. Außerdem sei man im Austausch mit dem ARD-Nachhaltigkeitsboard. Auch das ZDF ist ein Projektpartner des Forschungsprojekts. „Sobald hier Ergebnisse vorliegen, wollen wir diese in die Weiterentwicklung unserer Prozesse und Plattformen einbeziehen“, sagt Amelie Jakob, die Ansprechpartnerin für die Big Screen Applikation beim ZDF, gegenüber RESET. Mit der Big Screen Applikation ermöglicht der Sender den Nutzer:innen schon jetzt in den Einstellungsoption einen „reduzierten Stromverbrauch“. Damit wird u. a. das automatische Abspielen von Videos verhindert. „Diese Einstellungsoption soll in Zukunft noch verbessert und erweitert werden“, so Jakob.
Auch der deutsch-französische Sender ARTE bietet seinen Nutzer:innen in den Einstellungen verschiedene Möglichkeiten, klimafreundlicher zu streamen. Wie auch bei anderen Streaming-Anbietern kann die Qualität reduziert und die automatische Wiedergabe von Videos eingeschränkt werden. Zudem setzen ARTE und ZDF auf die Abwärtskompatibilität ihres Online-Angebots. Das heißt, dass auch ältere Betriebssysteme noch möglichst lange unterstützt werden. Dadurch können Nutzer:innen ihre Geräte länger einsetzen.
Die energiesparenden Optionen für die Nutzenden sind auf der Webseite von ARTE leicht auffindbar im Footer platziert. Damit sie öfter genutzt werden, könnten auch beim ZDF diese Optionen besser sichtbar platziert sein. Denn die Zuschauenden über die CO2-Emissionen ihres Streamingverhaltens und über die Optionen zu deren Reduktion zu informieren, kann wirkungsvoll sein. So hat eine Studie nachgewiesen, dass bereits die Informationsvermittlung nach einer Woche zu einem Rückgang der CO2-Emissionen um bis zu 30 Prozent führte. Noch besser wäre es natürlich, würden uns alle Videos als Standardeinstellung maximal energiesparend abgespielt.
Wie sieht eine grüne digitale Zukunft aus?
Elektroschrott, CO2-Emissionen durch KI, Wasserverbrauch von Rechenzentren – aktuell scheint die ungezügelte Digitalisierung nicht mit einem gesunden Planeten vereinbar. Doch es gibt viele Lösungen für eine ökologische und faire Digitalisierung – wir haben sie recherchiert:
Zum Video-Encoding hat ARTE ein optimiertes Verfahren in Zusammenarbeit mit dem Fraunhofer-Institut entwickelt und speziell auf den ARTE-Content-Katalog trainiert. „Videodaten werden dabei mit Hilfe eines ARTE-spezifischen KI-Modells zusätzlich komprimiert, um Speicherplatz zu sparen und eine effiziente Übertragung zu ermöglichen“, berichtet Kemal Görgülü, CTO von ARTE. „Als Faustregel liegen die Einsparpotenziale mit dem optimierten Video-Encoding bei ca. 10 bis 25 Prozent.“ Allerdings ist dies abhängig von dem Alter der Geräte der Nutzer:innen und der Art des Contents, der auf die Bildschirme übertragen wird. Dabei gilt, dass je neuer die Geräte der Nutzer:innen sind, desto höher sind meistens die CO2-Einsparungen.
„Der Strom für unsere Infrastruktur ist 100 Prozent grün“, hat uns Kemal Görgülü bestätigt. Das bezieht auch die Rechenzentren mit ein. Auch beim ZDF werden die Gebäude- und Studio-Infrastruktur und die ZDF-eigenen Server zu 100 Prozent mit Ökostrom gespeist, so Amelie Jakob.
Wir haben die Sender auch gefragt, wie viele CO2-Einsparungen mit den verschiedenen Maßnahmen erreicht werden. Laut Birgit Gabriel von ARTE sei das schwer zu beziffern. Das habe vor allem damit zu tun, dass sich oftmals mehrere Parameter gleichzeitig verändern. „So hat sich im Zeitraum der Einführung des Per-Title-Encodings auch der technische Umfang der bereitgestellten Dateiformate geändert. Gleichzeitig hat sich die Infrastruktur der von ARTE genutzten Distributionsnetze kontinuierlich verbessert, während der CO2-Fußabdruck dieser Netze gesenkt wurde.“ ARTE plant jedoch, in Zukunft genauere Messungen vorzunehmen, die u. a. das Nutzungsverhalten mit größerer Präzision abbilden werden.
Auch auf die Produktion versuchen ARTE und das ZDF Einfluss zu nehmen. ARTE ist Mitglied der französischen Association Ecoprod und schult seine Teams in klimafreundlicher Produktion. Die Koproduktions- und Ankaufsverträge des Senders enthalten zudem eine Klausel, die die Vertragspartner verpflichtet, eine CO2-Bilanz für die Produktion vorzulegen. Das ZDF hat als Gründungsmitglied von „Green Shooting“ ökologische Mindeststandards für die Programmproduktion mitentwickelt. Mittlerweile seien mehr als die Hälfte der fiktionalen Produktionen des Senders klima- und ressourcenschonend hergestellt, so Jakob.
Green Streaming entwickelt einen CO2-Rechner für Videostreaming
Im Projekt „Green Streaming wird von KlimAktiv ein Rechner entwickelt, der sich an Streaming-Anbieter und Sendeanstalten richtet, um die CO2-Emissionen der Streaming-Angebote ermitteln zu können. Ein Tool für Zuschauer:innen wird aktuell zusammen mit dem Konsortialpartner RBB auf Akzeptanz getestet. Damit soll vor allem der Energieverbrauch am Endgerät beeinflusst werden.
Erfreulicherweise passiert das alles nicht in einem Silo. Kemal berichtet, dass innerhalb der Branche sowohl auf Ebene der EU als auch zwischen den deutschen öffentlich-rechtlichen Sender ein regelmäßiger Austausch zu Best Practices stattfindet. Zudem konnten wir noch weitere Initiativen finden, die sich aufgemacht haben, die Umweltbelastung des Streamings zu reduzieren. Die mitgliederorientierte globale Organisation Greening of Streaming will beispielsweise die Streaming-Branche zusammenbringen, um gemeinsam an Maßnahmen zu arbeiten.
Der öffentlich-rechtliche Rundfunk geht also durchaus erste wichtige Schritte zur Reduktion der Streaming-Emissionen. Doch wie wir gezeigt haben, sind noch nicht alle Emissionsquellen im Detail bekannt. Und viele der Maßnahmen befinden sich aktuell noch in der Erprobungsphase. Es bleibt also noch viel zu tun – insbesondere für die großen On-Demand-Plattformen. Dringend nötig wären hier ähnlich umfassende Ansätze wie im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Ob sie aber ernsthaft gesellschaftliche Verantwortung übernehmen, ist mehr als fraglich.
Fazit: Streamen oder nicht streamen – ist das die Frage?
Das Öko-Institut hat die globalen Treibhausgasemissionen von Rechenzentren im Jahr 2024 auf etwa 230 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente geschätzt. 38 Millionen Tonnen sollen dabei auf KI entfallen. Nicht einbezogen sind hier die Emissionen der Nutzung von PCs, Laptops und Smartphones. Werden alle On-Demand-Streaming-Anbieter und YouTube miteinbezogen, verursacht Streaming schätzungsweise 50 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente – mindestens. Dieser Berechnung liegt – zur Erinnerung – die „optimistische“ Zahl von 55 Gramm an CO2-Äquivalenten pro Stunde Videostreaming zugrunde. Da hier auch die CO2-Emissionen des Stromverbrauchs der Geräte eingeflossen sind, hinkt der Vergleich zwischen KI und Streaming etwas. Und wer den Artikel bis hierher gelesen hat, weiß jetzt auch, wieso all diese Zahlen sowieso mit Vorsicht zu genießen sind. Doch trotz aller Unschärfen ist klar, dass wir es sowohl bei KI – und hier besonders GenAI – als auch beim Streaming mit enormen CO2-Emissionen zu tun haben. Nicht zuletzt zeigt sich das im rasant steigenden Strombedarf von Rechenzentren.
Was also bleibt ist eine klare Botschaft: All hands on deck! Und: Weniger (streamen) ist mehr (Klimaschutz)! Wie wir gezeigt haben, kommt uns als Konsument:innen eine wichtige Rolle zu, da unser Nutzungsverhalten für den Großteil der Emissionen beim Streamen verantwortlich ist. Als kleine Erinnerung: Weniger Binge, mehr Wertschätzung – und unbedingt die Einstellungen checken!
Gleichzeitig haben jene, die uns Bewegtbild und Musik auf unsere Bildschirme liefern, eine besondere Verantwortung. Wir haben gezeigt, dass es verschiedene Stellschrauben gibt, insbesondere die Formate, die „Liefernetzwerke“ und die Rechenzentren betreffend. Sehr wirkungsvoll wäre auch, wenn auf Anbieterseite CO2-armes Streaming zur Grundeinstellung wird.
Nur angekratzt haben wir das große Thema Produktion. Denn schon bevor ein Film im Angebot ist, entstehen massive CO2-Emissionen – und sowohl deren Ermittlung als auch gezielte Maßnahmen sind komplex! Im Leitfaden des Projekts „Green Streaming“ finden sich dazu einige spannende Berechnungen.
Nur angedeutet haben wir eine weitere große Stellschraube – oder sollten wir hier besser von einem Elefant im Raum sprechen? Die Rede ist von Online-Marketing. Rufen wir uns die unzähligen Werbevideos ins Gedächtnis, die das, was wir auf Social Media- und Streaming-Plattformen eigentlich sehen wollen, immer wieder unterbrechen, müssen ihre CO2-Emissionen hoch sein. Wir haben eine Erste-Hilfe-Maßnahme für Nutzer:innen genannt: Werbeblocker. Gleichzeitig ist aber auch eine Regulierung von Unternehmen und Sendern gefragt. Und dies betrifft nicht nur eine Einschränkung der Werbeinhalte. Vielmehr geht es darum, Unternehmen dazu zu verpflichten, alles mögliche dafür zu tun, Streaming klimafreundlicher zu gestalten – bei Default. Die Ansatzpunkte sind vielfältig, wir haben einige gezeigt.

Dieser Artikel ist Teil des Dossiers „Digital und grün – Lösungen für eine nachhaltige Digitalisierung“, in dessen Rahmen wir Lösungen für eine ökologische und faire Digitalisierung vorstellen. Wir danken der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU) für die Projektförderung!
Du willst keinen Artikel zum Thema verpassen? Dann abonniere unseren Newsletter oder RSS-Feed und folge uns auf Mastodon, Bluesky oder LinkedIn!
The post CO2-Riese Streaming: Wir müssen wieder mehr über Netflix, Prime und Co. reden! appeared first on Digital for Good | RESET.ORG.






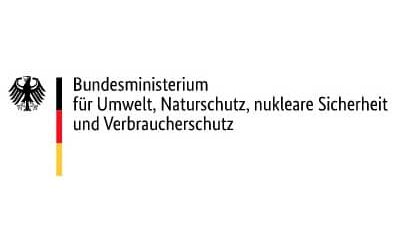
![Nachhaltiges Tagesgeld: Hier gibt es die besten Zinsen [August 2025]](https://komoneed.com/wp-content/uploads/2023/03/utopia-400x250.jpg)

0 Kommentare