This post was originally published on Good Impact
So gern wir alle reisen, vor allem weit weg – Tourismus und Fernreisen sind eine CO2-Schleuder. Die CO2-Emissionen der Branche wachsen mehr als doppelt so schnell wie die Gesamtemissionen, nach einer Studie im Fachjournal Nature Communications allein zwischen 2009 und 2019 jedes Jahr um 3,5 Prozent. Setzt sich das Wachstum mit dieser Rate fort, würden sich die Emissionen alle 20 Jahre verdoppeln. Herr Zeiss, sollten wir alle zu Hause bleiben?
Harald Zeiss: Sicher nicht, aber wir müssen überlegen, wie wir in der Klimakrise noch angemessen reisen können. Das größte Problem ist die Mobilität, insbesondere der Flugverkehr. Er verursacht 49 Prozent der Emissionen im Tourismus. Allerdings unterscheidet die Statistik nicht zwischen Urlauber:innen, Businessreisenden und Menschen, die Freunde oder Familie besuchen.
Haben Fernreisen da überhaupt noch Zukunft?
Petra Thomas: Guckt man nur aufs CO2, sicher nicht. So gingen 2023 zwar neun Prozent aller Reisen von Deutschland aus in die Ferne, also mehr als 3.500 Kilometer weit weg. Das ist der höchste Anteil an Fernreisen, der je gemessen wurde. Doch diese neun Prozent sind für 50 Prozent der gesamten Flugemissionen im Tourismus verantwortlich. Auch bei Reisen innerhalb Europas ist Fliegen gefragt wie nie zuvor. 48 Prozent flogen 2023 in den Urlaub, erstmals mehr als mit dem Auto (42 Prozent). Auf Bahn und Bus setzten gerade mal 5 Prozent.
Eine aktuelle Studie im Wissenschaftsmagazin Science schlägt daher vor: Langstreckenflüge begrenzen, höhere CO2-Steuern und ein individuelles CO2-Budget.
Zeiss: Aktuell emittiert jede:r Deutsche etwa 10 Tonnen CO2 im Jahr – nach wissenschaftlichem Stand sind ungefähr 2 Tonnen klimatisch vertretbar. Schon ein Hin- und Rückflug Economy Berlin-Bangkok emittiert pro Person gut 4,2 Tonnen. Ein individuelles CO2-Budget wäre daher ideal. Jede:r müsste mit seinem Budget haushalten, ein Markt würde entstehen, ähnlich wie der europäische Emissionshandel. Fliegen wäre um ein Vielfaches teurer, wie in den 1980ern vielleicht. Aber das ist völlig unrealistisch, wie wollen wir das umsetzen?
Die EU hat Emissionszertifikate für Flüge eingeführt …
Zeiss: … ja, aber das gilt nur für Flüge in der EU. International ist das nicht durchsetzbar. Auch Luftverkehrsabgaben helfen wenig, sie belasten zwar Fernflüge am meisten, doch sind sie so niedrig, dass die Abgabe völlig im Gesamtpreis untergeht. Und je höher die Abgabe, desto lauter die Stimmen, man wolle das Reisen verbieten.
Thomas: Im Forum anders reisen setzen wir uns dafür ein, die Ticketsteuer in eine zweckgebundene Abgabe für Klimaschutz und Wissenschaft zu verwandeln, zum Beispiel für die Erforschung neuer Kraftstoffe.
Fluggesellschaften behaupten, sie werden bald mit Kraftstoffen wie grünem Wasserstoff umweltfreundlich fliegen.
Zeiss: Der technische Fortschritt wird es richten, das hören wir seit Jahren. Hat er aber nicht. Mit Wasserstoff wird es vor 2035/40 keinen Flugverkehr mit regenerativer Energie in großem Maßstab geben. Synthetisch hergestellte eFuels oder Airline Fuels aus Biomasse sind viel zu teuer. Und so viel erneuerbare Energie, wie wir bräuchten, haben wir in absehbarer Zukunft gar nicht. Es stimmt zwar, dass Flugzeuge heute effizienter sind. Vor dreißig Jahren hat ein Flieger noch etwa 7 Liter pro 100 Kilometer pro Person in der Economy Class verbraucht, jetzt sind es knapp 3 Liter. Aber die Effizienzgewinne werden durch den weltweiten Anstieg des Flugverkehrs aufgezehrt.
Thomas: Ich denke, bei den Fluggesellschaften bewegt sich schon etwas. Die Internationale Vereinigung der Flugtransportgesellschaften IATA will bis 2050 30 Prozent der Flüge mit Biofuels, 36 Prozent mit E-Kerosin und 20 Prozent fossil antreiben und den Rest kompensieren. Norwegen stellt den Inlandsflugverkehr bis 2040 komplett auf Elektro um, andere werden folgen.
Zeiss: Ich glaube nicht, dass diese Pläne realistisch sind. Allerdings wäre schon viel erreicht, wenn weltweit zehn Prozent der Flüge nachhaltig würden. 1,4 Milliarden Ankünfte pro Jahr sind ein riesiger Hebel.
Was bleibt den Reisenden nun?
Thomas: Zum einen sollten Fernreisen die Ausnahme sein, alle drei oder fünf Jahre mal weit weg zum Beispiel. Zum anderen müssen wir sie so nachhaltig wie möglich gestalten. Unser Verband zum Beispiel orientiert sich bei Flügen am Atmosfair Airline Index, heißt: effiziente Maschinen, so direkt wie möglich fliegen, Umstiege konsequent vermeiden. Alle Ziele bis 800 Kilometer Entfernung dürfen von unseren Mitgliedsunternehmen nicht als Fluganreise angeboten werden. Für Flugreisen legen wir eine Mindestaufenthaltsdauer fest. Innerhalb Europas eine Woche, international zwei Wochen. Und ab 2025 werden wir alle Flugemissionen kompensieren.
Was ändert die Aufenthaltsdauer denn am CO2-Ausstoß eines Fluges?
Thomas: Nichts. Aber wir hoffen, dass die Zahl der Flüge dadurch sinkt. Man fliegt bewusster, der Shoppingtrip nach Mailand entfällt. Wenn die Leute länger bleiben, werden sie seltener reisen, ihr Kontingent an Urlaubstagen ist ja begrenzt. Zudem haben die lokalen Partner etwas davon, weil die Tourist:innen mehr Angebote vor Ort wahrnehmen. Ausflüge, Touren, Essen gehen.
Wie geht Mobilität im Tourismus umweltfreundlicher?
Zeiss: Indem wir Bus und Bahn ausbauen. Leider tut sich da viel zu wenig. Anders in China. Da gibt es jetzt eine Zugverbindung Shanghai–Peking (das ist so weit wie von Berlin nach Istanbul), in einer Nacht ist man da …
Thomas: … während es in Europa immer noch leichter ist, einen Flug auf die Fidschi-Inseln zu buchen als eine Bahnreise von Berlin nach Portugal. Man muss lauter Einzeltickets auf unterschiedlichen Seiten kaufen, oft x-mal umsteigen. Wir haben kürzlich mit der Hochschule Eberswalde eine Übersicht über 22 europaweite Verbindungen erstellt. Wie schnell sind sie, wie viel CO2 wird verbraucht? Mit dem Eurostar dauert es von Köln nach Schottland gut zehn Stunden, hätten Sie das gedacht? Mit einem Konsortium entwickeln wir nun Vorschläge für politische Regulierungen von Verkehrsunternehmen, damit Kund:innen innereuropäisch alle Tickets zusammen buchen können. Das ist wahnsinnig kompliziert, weil viele Verkehrsanbieter ihre Daten nicht herausgeben wollen. Immerhin gibt es neuerdings einen EU-Kommissar für nachhaltige Mobilität und Tourismus.
Warum hängen Nachtzüge eigentlich so zurück?
Zeiss: Für die Bahnbetreiber sind sie nicht sehr attraktiv. Sie stehen den ganzen Tag und fahren nur nachts eine Strecke, tagsüber können Züge mehrfach hin- und herpendeln. Aber die Österreichische Bundesbahn baut ihr Angebot aus, ähnlich die Niederlande und Schweden.
Grundlegend: Was heißt denn nachhaltiges Reisen genau?
Thomas: Im Forum anders reisen folgen wir einem 14-seitigen Kriterienkatalog von der Anreise über die Unterkünfte bis zu Touren. Wie hoch ist der CO2-Verbrauch, welche Materialien werden beim Bau von Hotels genutzt, wie werden die Beschäftigten bezahlt und abgesichert, wird Biodiversität geschützt? Touren mit Schneemobilen, Quads oder Motorrädern etwa sind genauso verboten wie Rundflüge oder Hotels, die den Zugang der einheimischen Bevölkerung zu Strand und Meer beschränken. Einheitliche detaillierte Vorgaben gibt es nicht, denn die Voraussetzungen sind in jedem Land unterschiedlich. In Katalonien, wo schon viel für Nachhaltigkeit getan wird, habe ich als Veranstalter andere Möglichkeiten als in Usbekistan. Das Machbare zählt. Das Gute ist: Ökologische Nachhaltigkeit lohnt sich oft auch finanziell. Wer Wasserverbrauch und Müll reduziert, spart Geld.
Und die großen Player der Branche? Haben sie wirklich verstanden, was die Klimakrise für sie bedeutet?
Zeiss: Manche der bekannten Reiseveranstalter stecken noch in den 1980ern fest, andere wie DER Touristik tun schon einiges, haben grüne Hotels im Katalog. Die Unternehmensgruppe AER startet gerade mit nachhaltigen Reisebüros. Die kleinen Anbieter für nachhaltiges Reisen machen den großen Beine, auch wenn sie gemessen am Umsatz nur zwei Prozent des Marktes abdecken. Und bei Giganten wie der TUI bringen schon einzelne Maßnahmen viel. Wenn die TUI in 30.000 Hotels weltweit den Wasserverbrauch reduziert, ist der Effekt riesig. Leider gibt es auch Greenwashing. Die Deutsche Umwelthilfe hat 2024 TUI Cruises für die Ankündigung „2050 Dekarbonisierter Kreuzfahrtbetrieb (Net zero)“ verklagt, das Landgericht Hamburg hat die Werbung untersagt. Richtig daneben war die Videokampagne der Deutschen Luftverkehrswirtschaft 2016, „Fliegen ist das neue Öko“, in der angeblich glückliche Alt-Hippies vom VW-Bus in ein „Vier-Liter-Flugzeug“ umsteigen.
Thomas: Umso wichtiger, dass gesetzlich viel mehr reguliert wird. Damit die Anbieter nicht Vorzeigeprojekte nach vorn stellen, während im Hauptgeschäft Nachhaltigkeit keine Rolle spielt. Genaue Zahlen gibt es nicht, die Firmen geben den Anteil nachhaltiger Angebote am Gesamtgeschäft nicht an, weil er vermutlich verschwindend gering ist. Immerhin werden wir als Verband für nachhaltiges Reisen jetzt zumindest häufiger eingeladen – um mit ihnen Konzepte zu entwickeln.
Die Weltorganisation für Tourismus, UN Tourism, will die Emissionen des Sektors bis 2030 halbieren.
Zeiss: Völlig uneinlösbar. Es fehlt schon an Daten, die zeigen, wo die Emissionen im Tourismus genau herkommen. Der Deutsche Reiseverband (DRV) hat mit dem gemeinnützigen Verein Futouris nun eine Plattform namens Klimalink ins Leben gerufen, damit Verbraucher:innen sehen können, wie viele Emissionen ihre Reise erzeugt. Das ist knifflig, denn bisher gibt es viele unterschiedliche Berechnungskriterien, die Angebote sind überhaupt nicht vergleichbar. Nach dem Stand der Wissenschaft müsste man die CO2-Emissionen von Flügen etwa mit drei multiplizieren, um auch Klimaeffekte zu erfassen, die in 10.000 Kilometern Höhe durch Kondensstreifen und Stickoxide entstehen. Alle Airlines und die IATA aber tun das nicht.
Bereiten sich die Reiseanbieter:innen vor Ort denn auf die Folgen der Klimakrise vor?
Zeiss: Es ist schon erstaunlich, wie viele davon ausgehen, dass es noch eine Weile gut gehen wird. Manche bauen noch schnell ein neues Hotel auf den Malediven. Das Kalkül: Lohnt sich noch, bevor die Flut kommt. Griechenland will massiv seine Flughäfen ausbauen. Die Hoffnung: Wird es zu heiß, kommen die Leute halt im Herbst oder Frühling. Dabei ist Coolcation absehbar, der Trend zum Urlaub in kühleren Regionen. Weniger Mittelmeer, mehr Ostsee. Wenn Millionen Reisende in den nächsten Jahrzehnten vor der Haustür Urlaub machen wollen, sehe ich da massive Probleme.
Thomas: Einige Destinationen im Süden passen sich bereits an. Kalatonien hat gerade einen Masterplan Wassermanagement entwickelt, sie mussten 2024 erstmals neun Monate lang wegen Wassermangels den Notstand ausrufen. Bauern experimentieren nun mit klimaresistenteren Trauben und sparsamen Bewässerungssystemen. Tourist:innen verbrauchen etwa viermal so viel Wasser wie Einheimische, schon weil sie oft zweimal am Tag duschen, Strand hin, Strand zurück. Der Wasserverbrauch wurde auf täglich 200 Liter pro Person begrenzt. Tourismus kann aber auch Teil der Lösung sein. Wenn durch die Gäste eine Meerwasserentsalzungsanlage finanziert werden kann, hat auch die Bevölkerung etwas davon. In Sansibar hat das ein Hotel gerade gemacht.
Viele Regionen im Globalen Süden hängen wirtschaftlich vom Tourismus ab. Das steht zunehmend in der Kritik: Die großen Reiseländer würden eigene Interessen verfolgen und den Aufbau anderer Wirtschaftssektoren bremsen.
Zeiss: Es kommt auf die Balance an. Tourismus hat sich vor allem da bewährt, wo wenig los war. Auf Inseln etwa, die vom Fischfang leben, aber tolle Strände haben und mangels Fachkräften nicht so attraktiv sind für andere Wirtschaftszweige. Ein Hotel ist schnell gebaut, Infrastruktur entsteht. Tourismus ist ein Jobmotor für wenig qualifizierte Menschen, er bringt viel mehr Geld in die Region als eine Raffinerie. Hotels, Restaurants, Touren.
Thomas: Entscheidend ist, dass die Menschen in der Region mitbestimmen, welchen Tourismus sie wollen und wie viel. Erst wenn das klar ist, sollten Reisecompanys und Locals gemeinsam Konzepte entwickeln. Meist werden dabei zu wenig soziale Kriterien berücksichtigt. Im Tourismus sind die Arbeitsbedingungen oft schlecht: Der Betrieb muss sieben Tage die Woche rund um die Uhr laufen, auch in den Randzeiten muss jemand arbeiten. In der Umgebung von touristischen Orten gibt es meist keine bezahlbaren Unterkünfte für Mitarbeiter:innen und ihre Familien. Viele müssen weit fahren, andere leben während der Saison in Notunterkünften. Die Beschäftigten brauchen Gehälter, von denen sie leben können und eine bessere Ausbildung, damit die höheren Positionen mit Einheimischen besetzt werden. Die meisten Managementpositionen werden mit Ausländer:innen besetzt.
Der Schriftsteller Navid Kermani sagte neulich, wir müssten uns die Offenheit, die Welt zu erkunden, bewahren, trotz aller Emissionen. Weil es unser Verständnis für andere Kulturen vergrößere und langfristig zu besseren politischen Entscheidungen führe.
Zeiss: Theoretisch würde das sicher jede:r unterschreiben. Aber praktisch? Die Deutschen reisen so viel wie nie, ich sehe gerade nicht, dass die kulturelle Offenheit gewachsen ist oder das Verständnis für den Wert der Natur. Ein Reiseveranstalter, der Kreuzfahrten in die Antarktis anbietet, sagte mir: Wenn meine Gäste das gesehen haben, wissen sie, was es zu schützen gilt. Aber was bringt das konkret? Sie verzichten dann vielleicht beim Kauf von Tomaten auf Plastiktüten, aber was durch die Emissionen auf der Reise zerstört wird, wiegt das nicht im Ansatz auf.
Thomas: Kultureller Austausch ist schon enorm wichtig. Zu fernen Kulturen zu reisen, ist seit der Antike ein grundlegendes Bedürfnis, der Mensch ist neugierig darauf, was hinter dem Horizont liegt. Aber wir kommen nicht drum herum, die Frequenz runterzufahren.
Wie viele Reisende sind bereit, nachhaltig zu reisen?
Thomas: 62 Prozent finden soziale und ökologische Themen beim Reisen sehr wichtig, die meisten buchen trotzdem nicht nachhaltig. Wir können als Branche die Verantwortung nicht auf die Gäste schieben, sondern müssen die Angebote so stricken, dass alles Nachhaltigkeitskriterien entspricht. Dann müssen Kund:innen nicht mehr entscheiden, grün oder nicht, sondern nur Hotel a oder b – weil Nachhaltigkeit selbstverständlich ist.
The post Haben Fernreisen noch Zukunft? appeared first on Good Impact.


![Nachhaltiges Tagesgeld: Hier gibt es die besten Zinsen [August 2025]](https://komoneed.com/wp-content/uploads/2023/03/utopia-400x250.jpg)
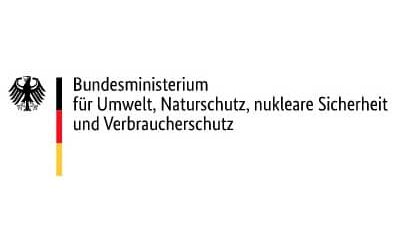

0 Kommentare